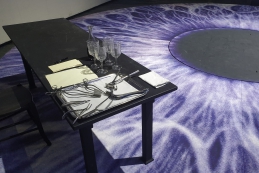Kritiken zu Opern-Aufführungen
- Details
- Geschrieben von: Kerstin Voigt
In diesem Jahr wird Puccinis 100. Todestag (29. November 1924) gedacht – da ist „Tosca“ in Erfurt (Premiere 28.9.2024) ein Muss. Das Haus füllt diese Oper zuverlässig, erst recht, wenn zusätzlich 75 Plätze auf der Bühne zum Sonderpreis angeboten werden. Einmal dort zu sitzen, sollte man sich nicht entgehen lassen, zumal, wenn man das Stück kennt und sich deshalb auf das von Stephan Witzlinger inszenierte Kammerspiel konzentrieren kann, das sich in aller Brutalität und Intensität direkt vor einem vollzieht.
Dramaturg Arne Langer wies vor Beginn die Besucher, die auf den Bühnenplätzen in einem hörsaalähnlichen Halbrund sitzen, darauf hin, dass sie als Beobachter, Mitwisser und - da ein Eingreifen nicht vorgesehen sei - auch als Mitschuldige an diesem Drama fungieren. Eine intensive Erfahrung! Auf Armeslänge von den Künstlern entfernt, sind deren Stimmen wie Emotionen stark zu spüren. Die Liebe zwischen Tosca und Cavaradossi ebenso wie sein erwachender Kampfgeist, um Angelotti zu retten.
- Details
- Geschrieben von: Kerstin Voigt
 Dieses „Rheingold“ beginnt mit dem Finale der „Götterdämmerung“! Bevor der Dirigent den Tankstock hebt, sehen (Vorhang-Projektion) und hören (knisterndes Feuer) wir den Weltuntergang nebst einer letzten (?) Begegnung von Wotan und Alberich. Kann man machen, macht auch Sinn, aber die akustische Qualität der Einspielung war ein Grauen!
Dieses „Rheingold“ beginnt mit dem Finale der „Götterdämmerung“! Bevor der Dirigent den Tankstock hebt, sehen (Vorhang-Projektion) und hören (knisterndes Feuer) wir den Weltuntergang nebst einer letzten (?) Begegnung von Wotan und Alberich. Kann man machen, macht auch Sinn, aber die akustische Qualität der Einspielung war ein Grauen!
Was dann folgte, war dank Jürgen R. Weber/Regie, Hank Irwin Kittel/Bühne und Tristan Jaspersen/Kostüme keine Minute langweilig! Man muss sich die Inszenierung am besten zweimal ansehen, um all die spielerischen, liebevollen oder sarkastischen „Kleinigkeiten“ zu entdecken und in der Musik zu hören – dort gibt es die nämlich auch. Manchmal bricht eins das andere, z.B., wenn zu hehren Klängen „Abendlich strahlt der Sonne Auge…“ dieses Auge auch inszeniert wird auf einer „Brücke“, die von oben einschwebt und es dann bis ins grausige Finale (mordender Wotan) vor sich hin zwinkert!
Die fantastisch bunt in Naturmaterialien kostümierte Harmlosigkeit der „Götter“ täuscht. Ihnen wird, wenn sie durch den Zuschauerraum auf die Bühne schreiten, ein abgeschlagener Kopf vorangetragen; es gibt undefinierbare blutige Rituale im Szenenhintergrund; Donner (Alik Abdukayumov) trägt einen blutigen Hammer, Froh (Tristan Blanchet) ist gegürtet mit Mengen von abgeschlagenen Hoden. Alberich büßt nicht nur einen Finger oder die Hand ein, wenn Wotan ihm den Ring entwindet – es ist der ganze Arm mit einem kettchenverbundenen Doppel-Unterarmreif.
- Details
- Geschrieben von: Kerstin Voigt
 Ein Spielzeitthema, 2023/24 lautet es „UFERLOS“, ist eine gute Sache. Die Opern „Rusalka“, aber natürlich auch „Das Rheingold“, „Peter Grimes“, „Die Stimme der Meerjungfrau“ und das Musical „Titanic“ haben es wesentlich mit Wasser zu tun, ja spielen teils unter Wasser.
Ein Spielzeitthema, 2023/24 lautet es „UFERLOS“, ist eine gute Sache. Die Opern „Rusalka“, aber natürlich auch „Das Rheingold“, „Peter Grimes“, „Die Stimme der Meerjungfrau“ und das Musical „Titanic“ haben es wesentlich mit Wasser zu tun, ja spielen teils unter Wasser.
Dass Wasser aber bei der szenischen Umsetzung von Rusalka so gut wie keine Rolle spielt und szenisch bis auf das Aquarium in Rusalkas Kellerloch, etwas Wasser im Küchenspülbecken und diverse Unterwasser-Bildprojektionen nicht weiter vorkommt, enttäuscht. Die Natur bleibt in dieser Inszenierung (vermutlich die letzte von Guy Montavon an diesem Haus) draußen oder ist bereits tot, wenn sie hereinkommt (Fische, Wild).
Ich habe in der Küche des herrschaftlichen Hauses aus dem 19. Jahrhundert wenigstens einen Ausblick auf Wasser oder Teich vermisst. Dass die Elfen dort als Küchenmädchen arbeiten, karikiert das Libretto – oder umgekehrt?! Anders als in Zürich, dort waren Najade, Dyade und Echo („Ariadne auf Naxos“) Serviererinnen in der Kronenhalle, geht hier das Konzept für mich nicht schlüssig auf. Vielleicht, weil es in dem originalen, märchenhaften Stoff kein Zwischenreich (nichts anderes ist diese Küche) gibt, sondern nur die beiden Welten (hier: Keller und großes Jagdzimmer). Anerkennenswert ist das opulente Bühnenbild, wie immer großartig gebaut - aber was trägt es zum Inhalt bei?
Daneben gegangen, weil gegen den Tenor der Musik und einfach nur albern inszeniert, ist die Szene der Jezibaba (Catherine Daniel). Hier erinnert die Hexe an eine sehr irdische Puffmutter und die Zubereitung des Trankes mitsamt der Bühneneffekte lächerlich und total überzogen. Jezibaba ist ein Mensch wie alle - das ist in dieser Inszenierung so gewollt. So kann das zentrale Motiv, die Verwandlung, aber kaum überzeugen. Rusalka ist von Anfang an keine Nixe, Jezibaba muss ihr keinen Menschenkörper mehr geben. Die Verwandlung ist nur noch eine „Kleidersache“, „Statusangelegenheit“. Das beraubt die Oper ihrer tiefsten Botschaft: aus Liebe bereit zu sein, das eigene Wesen aufzugeben, um einem Menschen nah sein zu können – und daran zu scheitern.
- Details
- Geschrieben von: Kerstin Voigt
Wenn sich der Vorhang öffnet, blickt man in einen bühnenfüllenden und bis auf die Hinterbühne reichenden grauen (Autobahn-)Tunnel mit Seitenausgängen rechts und einem kleinen Seitenpodest links, dessen Zugänge in die Welt der Chrysothemis führen.
Die fünf Mägde sind als Tunnelarbeiterinnen kostümiert, Elektra ist mit ihrem Koffer beschäftigt, in dem sich das Beil und der Mantel von Agamemnon befinden, den sie überstreift, bis Orest sie daraus befreit.
Gleich ein mehrfaches Déjà-vu! Der Tunnel und die wie Tunnelarbeiter kostümierten Nibelungen im Berliner Götz-Friedrich Ring; Koffer und Mantel für Elektra, der Rollstuhl für Klytämnestra wie in Lauffenbergs Wiener Elektra-Inszenierung. Sie alle passen, szenisch wie musikalisch, hier. Vor allem der Tunnel(trichter) entspricht der monumentalen Klangfülle und wirkt zugleich stimmenverstärkend.
Die die düstere, spannungsgeladene Bedrohung, die sich schon am Beginn in dem mächtigen Orchesterschlag (d-moll-Akkorde, Agamemnon-Thema) manifestiert, brach im Verlauf jedoch immer wieder ein. Für mich jedenfalls hat sich die sprichwörtliche „soghafte Wirkung“ zwar bildlich, aber musikalisch nur phasenweise eingestellt. Wohl vor allem deshalb, weil Alexander Prior, 29 und neuer GMD des Philharmonischen Orchesters Erfurt, verstärkt durch Mitglieder der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, an einigen Stellen auffällig langsame Tempi wählt. Auffällig in Elektras Monolog, späterhin fallen Generalpausen als spannungsstörend auf und vor allem die zu getragen zelebrierte Schlusstakte.
Es war Jessica Rose Cambio, als Chrysothemis die mit ihrem Auftritt für den ersten Spannungsschub des Abends sorgte. Die Partie liegt voll in ihrer stimmlichen Reichweite.
- Details
- Geschrieben von: Kerstin Voigt
„Ein Wunder! Ein Wunder! Ein Wunder ist gekommen…“
Für die Protagonisten, Margrethe Fredheim und Uwe Stickert, grenzt es vielleicht wirklich an ein Wunder, dass sich ihre Herzenswünsche, Elsa und Lohengrin singen zu dürfen, erfüllt haben. Es ist für beide die erste Wagner-Partie und die Debüts gelangen!
Uwe Stickert kenne ích seit vielen Jahren als Solist in Oratorien, Passionen, Kantaten und Motetten und staunte, als ich von seiner Besetzung erfuhr. Da erst begann ich zu realisieren, dass er quasi „nebenbei“ eine sehr kluge Entwicklung im Bereich der Oper genommen hat: über Rodrigo, Ferrando, Ernesto (Weimar), Tamino, Belmonte (Weimar und Erfurt), Don Ottavio (Münster), David , Steuermann (Budapest), Titus und Idomeneo (Würzburg ), Flamand (Innsbruck), Heinrich (Lanzelot) in Weimar und Erfurt und einige weitere Rollen aus dem französischen Repertoire (Gounod, Meyerbeer). Uwe Stickert ist längst in der Oper angekommen. Im März folgt der Florestan in Cottbus.
Seine helle Stimmfarbe mit metallischem Kern, der zur Attacke fähig ist, seine perfekte Phrasierung, seine strahlenden nie gefährdeten Höhen und absolute Wortverständlichkeit machen seinen Lohengrin zum Genuss!
Margrethe Fredheim als kongeniale Partnerin mit schon nicht mehr „nur“ lyrisch-leichtem, sondern starkem, strahlendem Sopran meistert die Partie ebenso gut. Wie richtig, dass Intendant Guy Montafon ihr sie zugetraut hat. Es ist die bisher größte Rolle der gebürtigen Norwegerin, die seit der Spielzeit 2015/16 zum Erfurter Ensemble gehört.
In einem Interview mit der Thüringer Allgemeinen Zeitung vom 31.1.2020 ist nachzulesen, dass Wagner für sie überhaupt der Grund gewesen sei, warum sie Sängerin wurde – nach einer Tannhäuser-Aufführung in Oslo war das alternativlos. Aber der große Respekt vor ihm ist geblieben. Drei Stunden ist Elsa auf der Bühne, da sind volle Präsenz und Konzentration erforderlich. Optisch bleibt sie in der Inszenierung, anfangs barfuß im weißen Kleid, die Menschlichste unter seltsam gleichgeschaltet wirkenden „Cyborgs“ der Zukunft.